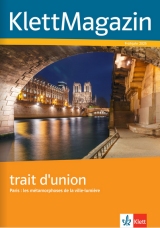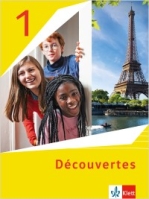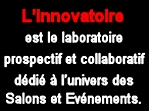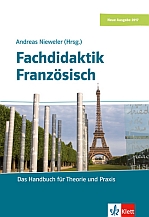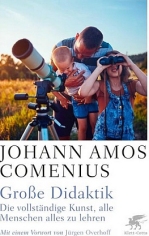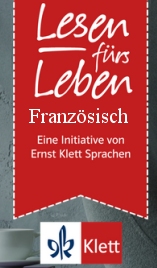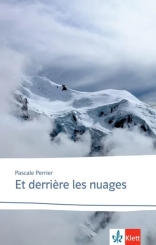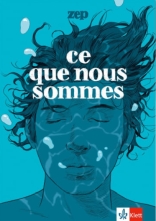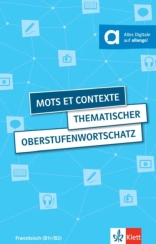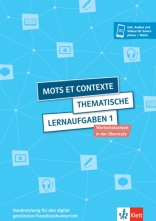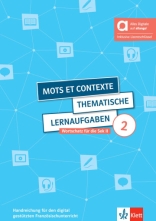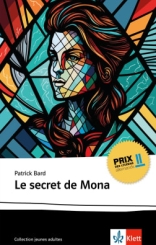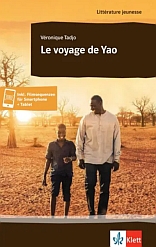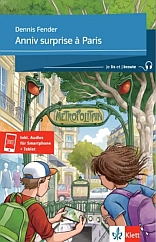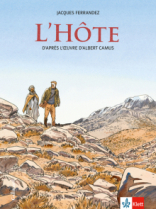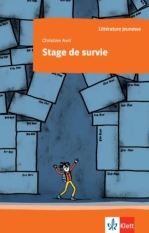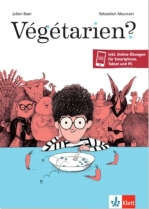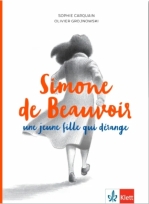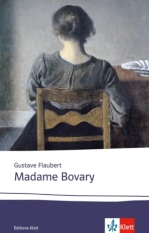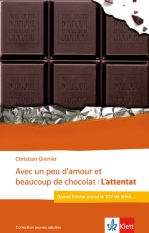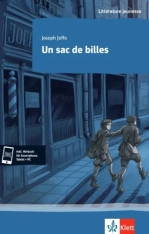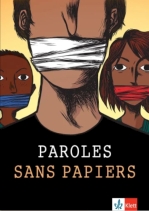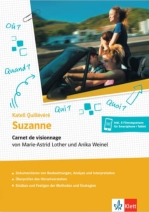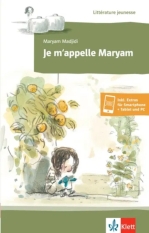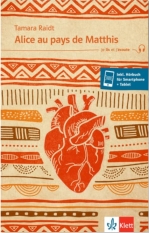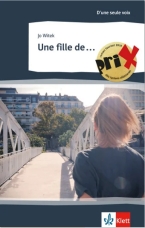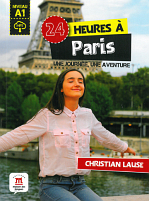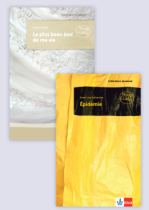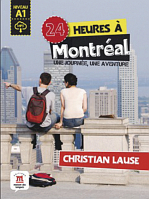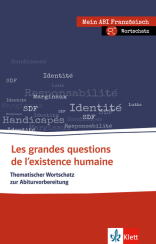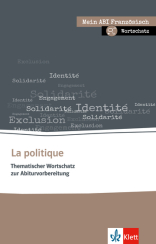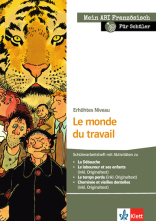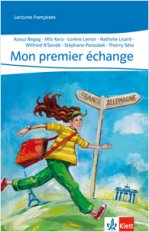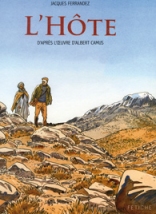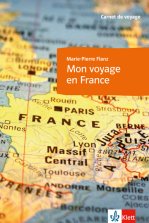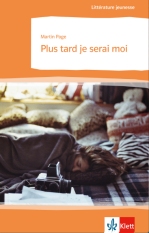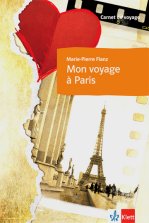Gerade kommt hier der Blog von Hans Ulrich Gumbrecht, Literaturprofessor in Standford, > Digital/Pausen auf den Bildschirm. Am 7. September 2012 dort wurde ein neuer Beitrag > Wie sich die Intellektuellen überlebt haben angezeigt. Man darf die Frage stellen: Wieso soll es mit den Intellektuellen zu Ende sein? Das hat schon François Lyotard mit seinem Tombeau des intellectuels et autres papiers, Paris 1984, so erfolglos zu behaupten versucht.
Der Beitrag von Gumbrecht beginnt mit einer Behauptung: „Kein Politiker im einundzwanzigsten Jahrhundert verlässt sich mehr auf die Meinungen und den Rat von Intellektuellen, nicht einmal im Südamerika der Charismatiker wie Chávez und Lula, wo sich länger als in Europa ein oft mit dem Gesicht von Ché Guevara assoziierter spät-romantischer Glaube an ihre überlegene Urteilskraft erhalten hatte.“ Vielleicht ist da ein bisschen was dran, bedenkt man, dass viele unserer Politik keine Intellektuellen sind. Gumbrechts 2. Satz:“Selbst als das Kanzleramt in Berlin einen „Ethikrat“ einberief, von dem seit seiner Gründung so wenig die Rede war, dass man heute gar nicht mehr weiß, ob er noch existiert, wurden seine Mitglieder als Spezialisten für Fragen der Moral ausgewählt – und nicht aufgrund eines früher grundsätzlich als provokant begrüßten Rufs als Intellektuelle.“ Gumbrechts Schlussfolgerung im ersten Absatz: „Wir erleben eine Gegenwart von Spezialisten, die unsere Welt in ihren je verschiedenen Dimensionen so gut es geht am Laufen und Leben halten,(…) selbst charismatische Politiker, Politiker, die nicht beständig von Spezialisten beraten werden wollen, trauen eher ihren eigenen Intuitionen als denen der Intellektuellen.“ Wie gesagt, im heutigen Politikbetrieb mögen Intellektuelle nicht mitmachen. Diese Erkenntnis ist aber kein Grund, von einem Verschwinden der Intellektuellen zu reden, oder ihren Untergang herbeizureden. Intellektuelle sind unabhängig, sie lassen sich nicht immer, wie man das so immer so gerne möchte klassifizieren, vereinnahmen und für die Zwecke anderer einsetzen. Kommissionen heißen im politischen Umfeld immer gleich Expertenkomissionen, damit werden sie auf ihr Spezialistentum und nicht auf ihre Unabhängigkeit festgelegt. Sie haben die von der Politik erwarteten Ergebnisse zu liefern, so wie der Bundestag heute meistens die in den Fraktionen ausgehandelten Ergebnisse abzunicken hat.
Lesen wir bei Gumbrecht weiter. „Doch woher kam ihre heute so vergilbte Aura?“ (der Intellektuellen, w.) Er erwähnt den Begriffswandel vom „philosophe,“ „so hieß es im einschlägigen Artikel der „Encyclopédie“ von Diderot und d’Alembert, sei jemand, der ungelöste Fragen und Probleme der Gesellschaft aufgreift“ zum „intellectuel“ der Prägung Zolas: „J’accuse“ (1898). Dann nennt Gumbrecht eine „dritte, aus der Retrospektive des frühen einundzwanzigsten Jahrhunderts identifizierbare Schwelle in dieser Geschichte“. „Sartre entschied sich für eine Festlegung auf die Positionen des damals noch von der Sowjetunion in problematischer Einheit zusammengehaltenen Kommunismus, während Camus seit etwa 1950 explizit von genau dieser Möglichkeit Abstand nahm, weil er die Zumutung des Sozialismus und Kommunismus für unannehmbar hielt…“
„Sartre entschied sich für eine Festlegung auf die Positionen des damals noch von der Sowjetunion in problematischer Einheit zusammengehaltenen Kommunismus, während Camus seit etwa 1950 explizit von genau dieser Möglichkeit Abstand nahm, weil er die Zumutung des Sozialismus und Kommunismus für unannehmbar hielt, eine jeweilige Gegenwart individuellen Lebens bestimmten abstrakten Kollektiv-Zielen (der Herbeiführung einer „klassenlosen Gesellschaft“ zum Beispiel) unterzuordnen, deren Realisierungschancen er für prekär und jedenfalls allzu langfristig ansah,“ schreibt Gumbrecht und wiederholt vorgefasste Ideen in Bezug auf das Werk von Sartre, die den Niedergang oder das Verschwinden des Intellektuellen suggerieren sollen. Ohne Zweifel wollte der Autor von L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique (1943), sein Werk über die Freiheit, von 1951-1956 ein Wegbegleiter der PCF sein, die sich seiner Einflussnahme aus leicht verständlichen Gründen stets beharrlich verweigerte. Würde Gumbrecht Sartres Kritik am Marxismus zitieren, würde man die Überlegenheit des Intellektuellen leicht erkennbar. Vgl. H. Wittmann, Sartre und die Kunst. Die Porträtstudien von Tintoretto bis Flaubert, Verlag Gunter Narr: Tübingen 1996, S. 72-88: Die Kritik am Marxismus.
Zwei Sätze aus Sartres Fragen der Methode, neu hrsg. v. A. Elkaïm-Sartre, übersetzt v. V. v. Wroblewsky, Reinbek bei Hamburg 1986. op. cit., S. 35: „Der Marxismus besitzt theoretische Grundlagen, er umfasst alle menschliche Aktivität, aber er ist kein Wissen mehr, seine Begriffe sind Diktate; sein Ziel ist nicht mehr, Erkenntnisse zu erlangen, sondern sich a priori als absolutes Wissen zu konstituieren. Angesichts dieser doppelten Unwissenheit hat der Existentialismus wiedererstehen und sich behaupten können, weil er die Wirklichkeit des Menschen wieder zur Geltung brachte, wie Kierkegaard gegen Hegel.“ Fragen der Methode erschien ursprünglich in einer polnischen Zeitschrift 1960, in einer Übersetzung in der Taschenbuchreihe bei Rowohlt unter dem Titel Marxismus und Existentialismus (übers. v. H. Schmitt, Hamburg 1964) , und als zusätzliches Vorwort zu der Critique de la raison dialectique (1960), aber nicht in deren deutschen Übersetzung. Fragen der Methode ist eine fundamentale Anklage des Kommunismus stalinistischer oder sowjetischer Prägung. Der Versuch, Sartre in die Nähe des Marxismus zu stellen, sein Scheitern anzuzeigen und damit auch zugleich die Figur des Intellektuellen als obsolet erscheinen zu lassen, funktioniert so nicht.
Wenn man hingegen seine Vorträge aus Japan Plädoyer für die Intellektuellen<. Interviews, Artikel und Reden 1950 - 1973, Übersetzt von H. v. Born-Pilsach, E. Groepler, T. König, I. Reblitz, V. v. Wroblewsky, in: ders., Gesammelte Werke in Einzelausgaben (Hrsg. V. v. Wroblewsky), Politische Schriften, Bd. 6, Reinbek bei Hamburg 1995), wieder liest, würde man schnell merken, dass das mit dem Verschwinden des Intellektuellen auch gar nicht so einfach ist: „Ohne grundsätzliche Positionen aufzugeben, hat Sartre in seinem Werk besonders nach 1970 durch sein politisches Engagement die Entwicklung des klassischen Intellektuellen zu einem Intellektuellen neuen Typs zeigen wollen. In den drei Vorträgen, die er 1965 in Kyoto und Tokio gehalten und unter dem Titel Plaidoyer pour les intellectuels veröffentlicht hat, entwickelt er seine Theorie des Intellektuellen, der sich dadurch auszeichnet, dass er seinen engen Fachbereich überschreiten könne. Seine Kritiker in Japan und Europa richten den gleichen Vorwurf an ihn: „[…] der Intellektuelle ist jemand, der sich um Dinge kümmert, die ihn nichts angehen. […]“. (Sartre, Plädoyer für die Intellektuellen, loc cit., S. 91) Wissenschaftler, die eine Atombombe bauen, sind für Sartre keine Intellektuellen. Sie werden es erst, wenn sie z. B. gemeinsam ein Manifest unterschreiben, um ihre Mitmenschen vor dem Gebrauch der Bombe zu warnen. Mit der Beurteilung ihrer Zerstörungskraft überschreiten sie die ihnen gesetzten Grenzen ihrer Fachkompetenz. … Das Wertesystem, auf das sie sich berufen, hat das menschliche Leben als oberste Norm.“ (W., Sartre und die Kunst, op. cit., S. 166)
Mit 1968 folgte für Gumbrecht „die Einsicht (…) dass Intellektuelle mit parteipolitischen Festlegungen die für ihre Rolle wesentliche Möglichkeit verloren, von außerhalb der politischen Institutionen (und größere Komplexität der Meinungen schaffend) in ihren Gesellschaften zu intervenieren.“ Und Gumbrecht versteht die „Camus-Renaissance“ der letzten Jahre als eine Bestätigung, dass Intellektuelle verschwinden (?).“ All das schien und scheint weiterhin plausibel — und doch lässt sich nicht übersehen, dass der Einfluss“, ja die bloße Sichtbarkeit der verbleibenden Rand-Intellektuellen in den vergangenen Jahren weiter geschwunden ist und sich inzwischen wohl tatsächlich einem potentiellen Nullpunkt nähert.“ Gumbrechts Versuch Camus gegenüber Sartre – zu dessen Nachteil – in ein positives Licht zu stellen, erinnert an Michel Onfray, L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus, Paris: Flammarion, 2012: > Rezension: Albert Camus, ein Philosoph?
Nun kommt aber der Satz, der in Gumbrechts Blogbeitrag den meisten Widerspruch herausfordert: „Vielleicht liegt der Grund für das geräuschlose Verschwinden der Intellektuellen darin, dass jene innergesellschaftliche Komplexität, die allein sie herstellen können (und bisher auch herstellen sollten), nicht mehr gebraucht wird. (…) In solcher Ausdifferenzierung, deren Eigenkomplexität gegen unendlich geht, ist die traditionell Komplexitätsstiftende Funktion der Intellektuellen überflüssig geworden.“
Die Unabhängigkeit der Intellektuellen, ihre Ablehnung, sich klassifizieren, einordnen zu lassen, ihre bedingungslose Freiheit, ihre Befugnis, sich überall einzumischen, stört besonders den Berliner Politikbetrieb. Die Resignation einiger oder vieler, sich das nicht anzutun, hat nichts mit dem Verschwinden der Intellektuellen zu tun. Das Gerede von ihrem Untergang ist ein Angriff auf ihre/unsere Freiheit und ihre/unsere Unabhängigkeit.