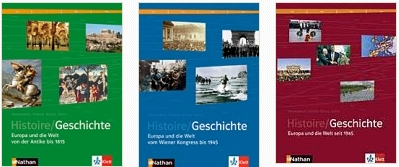| [wp-cumulus] |
|
Zum Anklicken: Die Themen auf diesem Blog |
Dieser 1500. Beitrag auf diesem Blog ist ein willkommener Anlass, den kürzlich in LE MONDE erschienenen Aufruf zu würdigen und hier gleich etwas Grundsätzliches zu den deutsch-französischen Beziehungen zu schreiben.
Am 28. Juni 2012 hat LE MONDE den Artikel > Pour un renouveau dans les rapports franco-allemands von Wolfgang Asholt, Henning Krauss, Michael Nerlich, Dietmar Rieger, Evelyne Sinnassamy, Joachim Umlauf veröffentlicht.
> Pour un renouveau dans les rapports franco-allemands
LE MONDE 28. Juni 2012
Die Autoren erwähnen u.a. Bernard de Monferrand, Jean Louis Thiérot, > France Allemagne. L’Heure de vérité (Paris: Tallandier 2011) aber auch Jacques-Pierre Gougeon, France-Allemagne: une union menacée, 2012 und > Allemagne, les défis de la puissance, La documentation française, 2012. Die Autoren dieses Beitrags verleihen ihren Sorgen angesichts der Polemik um das „deutsche Modell“ Ausdruck, die den Präsidentschaftswahlkampf im Frühjahr 2012 in Frankreich bestimmt hat. Sie haben Recht, Missverstehen hat diese Diskussion geprägt, und der damalige Präsident und die Bundeskanzlerin haben es nicht geschafft ja gerade versäumt, die bereits erzielte Aufmerksamkeit für das Thema – und das war doch schon ein gemeinsamer Erfolg – in eine produktive gemeinsame Richtung zu lenken. Deutsch-französische PR wäre angesagt gewesen. Institutionen gibt es dafür genug. Stattdessen wurde das Thema, als die Medien es aufgriffen, schnell wieder weggepackt.
Dieser Beitrag könnte
ein Thema oder Aufhänger für eine Schülerarbeit sein:
Analysez le débat actuel autour des relations franco-allemandes et formulez vos suggestions. |
|
https://twitter.com/FranceBlogInfo/status/235019751259258881
Erinnern wir uns, zunächst ist Angela Merkel bei einem Wahlkampfauftritt mit Nicolas Sarkozy dabei, sie werden zusammen interviewt. Diese Wahlkampfunterstützung wird aber im Verlauf des Wahlkampfes von Sarkozy nicht mehr genutzt. Mit dem Auftritt der Kanzlerin glaubt Sarkozy doch nicht so punkten zu können, wie er das anfänglich geglaubt hatte. Was war passiert? Hier geht es um die Feinmechanik in den deutsch-französischen Beziehungen: Perzeption nennt man das in der Politischen Wissenschaft. In Frankreich kam die Unterstützung der Bundeskanzlerin für Sarkozy als Einmischung in den Wahlkampf an, und Sarkozy musste schnell einsehen, dass er mit dem „deutschen Modell“ doch nicht so punkten konnte. Hinzukommt, dass die Kanzlerin zunächst sich nicht mit der Kritik von Sarkozys Herausforderer beschäftigen wollte. Eine echte Chance zum einvernehmlichen Dialog wurde (zunächst) nicht genutzt.
Vgl. > Sarkozy-Hollande : deux conceptions du modèle économique allemand – LE MONDE, Fondation Jean-Jaures | 29.02.2012 à 11h19 • Mis à jour le 15.03.2012
Friktionen, Missverständnisse, wachsende Distanz?
Betrachtet man von außen die beiderseitigen Beziehungen, so fühlt man sich wieder an die Friktionen beim Amtsantritt von Sarkozy erinnert, als es mit dem deutsch-französischen Paar nicht so recht klappen wollte. In ihrem Artikelaufmacher beklagen die Autoren, dass Deutsche und Franzosen sich von einander entfernt hätten.
Michel Serres: Ein Plädoyer für mehr Gemeinsamkeit
Anlässlich der > Verleihung des Meister Eckhart Preis 2012 in Köln hat Michel Serres > in seiner Dankesrede am 3. Mai 2012: Für die Verschmelzung plädiert: „Diese Vereinigung sollte weder die Form einer Nation noch die des Vaterlandes annehmen, da die historisch damit verbundenen Emotionen und Ideen bis in die jüngste Vergangenheit bereits zu viele Kriege und Tote nach sich gezogen haben. Das berauschende Gefühl der Zugehörigkeit wäre mit schrecklichen menschlichen Verlusten erkauft. Wie ich eingangs erwähnte, sollten wir weniger in Kategorien wie Gemeinschaften, Ländern, Einheiten, Gebieten oder Landkarten denken, sondern vielmehr an die Menschen denken.
https://twitter.com/FranceBlogInfo/status/234999485468651521
Die Verschmelzung müsste sich also auf direktem Wege zwischen den Deutschen und den Franzosen ergeben, das heißt unmittelbar von Individuum zu Individuum vollzogen werden.“ In Deutschland denkt man nicht in diesen Kategorien, wenn auch Pierre Nora in der FAZ > Man hat sich auseinandergelebt (16.2.2012) (Hier auf dem Blog: > Pierre Nora: “Die humanistische Kultur ist am Ende.”)die immer größere Leere im deutsch-französischen Dialog beklagt hat. Und auf beiden Seiten ist es trotz vieler > Anstrengungen nicht gut um das Erlernen der Nachbarsprache bestellt.
> Dankesrede von Michel Serres französisch PDF
Pour un renouveau dans les rapports franco-allemands
Die Autoren des Artikels in LE MONDE lancieren einen Aufruf zugunsten einer Erneuerung der deutsch-französischen Beziehungen und erinnern daran, dass nach 1945 die Aussöhnung mit Frankreich ein konstitutiver Bestandteil beim Wiederaufbau einer kulturellen deutschen Identität gewesen ist. In diesem Zusammenhang erinnern die Autoren mit Nachdruck an > die wichtige Passage im Elyseevertrag von 1963, der die Absicht der beiden Länder dokumentierte, den Sprachunterricht nachhaltig fördern zu wollen. Dieser Blog mit seinen 1500 Beiträgen seit September 2006 (> Argumente für Französisch) hat nichts anderes im Sinn. Würde diese Passage des Elyseevertrages und alle sonstigen Kulturabkommen mit Leben erfüllt werden, würde sich das Blatt bald zum Guten wenden.
>
Das Fach Französisch verdient mehr Aufmerksamkeit
> Appel pour la Renaissance des relations franco-allemandes. Von der Normalisierung zur Entfremdung? Aufruf zum Deutsch-Französischen Verhältnis
Die Autoren sprechen sich mit Nachdruck für ein neues deutsch-französisches Forschungszentrum aus. Der Kern ihres Anliegens ist nicht eine Wirtschafts- und Finanzpolitik „ohne Alternative“, sondern „die Schaffung günstiger Bedingungen für eine lebendige und produktive Präsenz der Geschichte und der gemeinsamen deutsch-französischen Kultur im Gedächtnis beider Völker.“
Die Defizite sind größer, als es in dem Artikel dieser Autoren anklingt. Meine Enttäuschung war riesengroß, als NRW mir nach einen Studium dreier Fächer mit zwei Jahren in Paris, einer fast beendeten Promotion und einem Referendariat in einem bilingualen Gymnasium die Einstellung in den Schuldienst verweigerte, aber gleichzeitig ein beeindruckendes Gesamtschulprogamm anwarf. Der Stachel saß lange Zeit ziemlich tief. Mehrere Generationen bestens ausgebildeter Französischlehrer wurden nicht in die Schulen gelassen, weil man glaubte, für sie keine Verwendung zu haben. Seitdem wundert man sich, dass die Zahl der Schüler die Französisch lernen, zurückgehen. Die totale Ernüchterung folgt aber erst noch: Was erfahren Französischschüler über das Nachbarland?
Ingo Kolboom >
Thesen zur Zukunft des Französischen, in: DOKUMENTE 4/1999, S. 281-283.
ders., > Was wird aus der Sonderbeziehung? Plädoyer für eine neu deutsch-französische Nähe. Wider die „Normalisierung“ als Diskurs der Entfremdung, in DOKUMENTE, 3-2000, S. 207-214
Es gibt interessante Projekte, man muss mehr über sie sprechen!
Wie wird bei uns in den Schulen für das Erlernen der französischen Sprache geworben? > Prix des lycéens allemands und viele andere Initiativen, > Klett engagiert sich für das Fach Französisch könnten noch größere Wirkung entfalten, wenn die Politiker und die Regierungen beider Länder einen größeren gemeinsamen Rahmen für die Kulturarbeit in beiden Ländern eröffnen würden. Eine Website mit einem deutsch-französischen Austauschprogramm das wär’s. Viele Französischschüler bei uns kennen noch nicht das > DFJW. Mein „Poisson d’avril“ > Promouvoir la langue française en Allemagne / Mehr Deutsch lernen in Frankreich war eine gute Gelegenheit, einmal so richtig von der besten aller Welten im deutsch-französischen Kulturbereich zu träumen.
Sucht man in Google nach dem > deutsch-französischen Jugendparlament findet man Einträge von 2003, die an ein feierliches und wohl leider einmaliges Ereignis erinnern. Wie wärs mit einem deutsch-Wettbewerb, dessen Gewinner jährlich das deutsch-französische Jugendparlament medienwirksam bilden dürften? Wir brauchen in den deutsch-französischen Beziehungen mehr Phantasie, mehr Kreativität, nicht nur Finanzen, sondern Politiker, die sich die Sache der Zivilgesellschaft zu eigen machen.
>
Deutsch-Französische Agenda 2020
> Les relations franco-allemandes et la société civile
> Deutsch-französische Beziehungen – 269 Artikel auf diesem Blog
Die meisten der Themen dieses Blogs kommen im Schulunterricht nicht vor und Schüler wählen oft das Fach Französisch ab, ohne viel über Frankreich zu wissen. Die > Lehrbücher zeigen, dass der Anteil der Literatur im Französischunterricht nach einer Zeit der sagen wir kommunikativen Didaktik allmählich wieder ansteigt. Mir geht das nicht schnell genug. Solange Schüler immer noch mit Albert Camus lernen, das das Leben absurd ist, statt > Camus‘ Absurdität als eine Diagnose vermittelt zu bekommen, aus der ein Aufbruch für Freiheit und Kunst erfolgt, wird sich im Literaturunterricht nicht viel ändern.

Aber ein Blick auf das > Lektüreangebot für Französisch mit 446 Titeln zeigt, das im Französischunterricht doch gelesen wird, sonst könnte ein Verlag ein solches Angebot nicht bereithalten. Viele Klagen über das deutsch-französische Verhältnis entstehen auch, weil zu wenig über unsere gemeinsamen Projekte und über die gemeinsamen Erfolge gesprochen wird. Die vielen gemeinsamen Initiativen sind zu wenig bekannt: 330 Beiträge über > deutsch-französische Veranstaltungen auf diesem Blog sind aber doch recht beeindruckend? Oder das > deutsch-französische Geschichtsbuch? Dennoch bleibt der Eindruck, dass die Politiker in der Öffentlichkeit die deutsch-französischen Beziehungen nur zu gerne als einen Anlass verstehen, den Wunsch, künftig enger zusammenarbeiten zu wollen, wieder einmal zu bekräftigen, anstatt die Ergebnisse ihrer Arbeit vorzutragen.
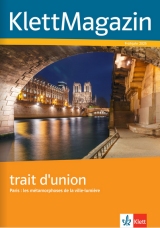



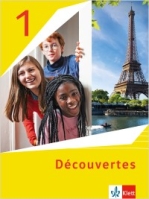





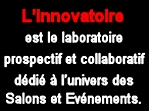


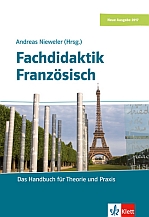
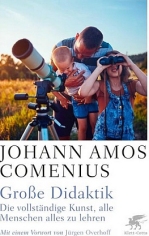



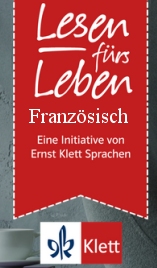
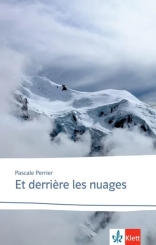
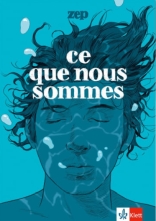
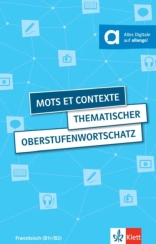
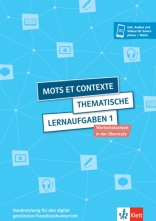
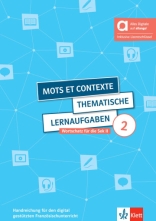
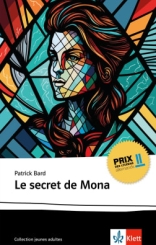

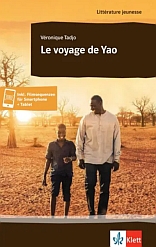

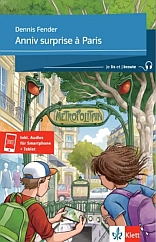

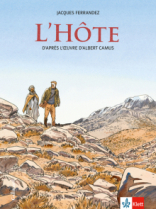

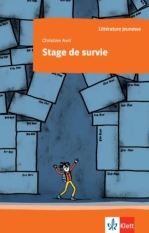
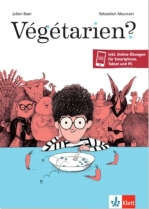
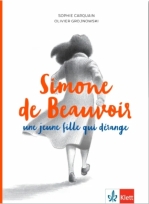
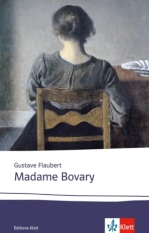
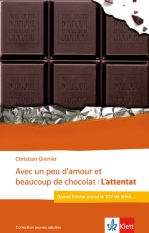
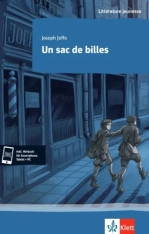
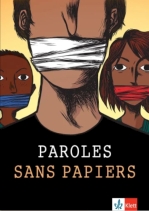

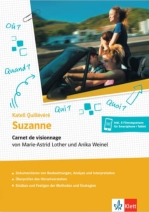
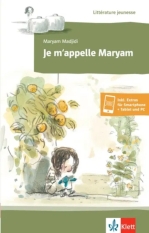

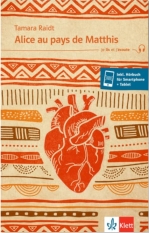

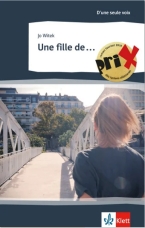

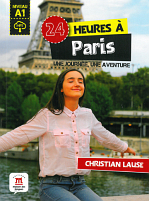




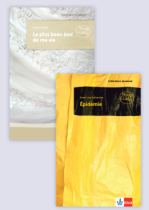
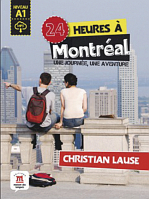
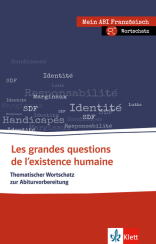
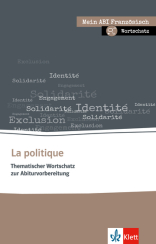

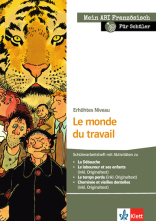
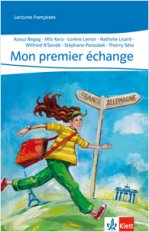
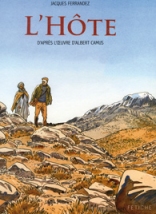
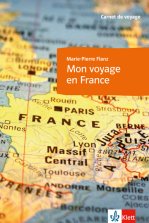
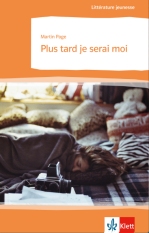
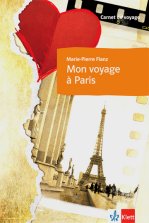

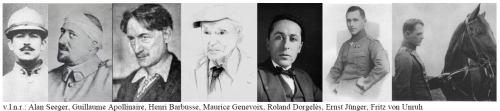


 Guéna hatte im Frühjahr 1940 de Gaulle kennengelernt. Heute ist er Ehrenpräsident der >
Guéna hatte im Frühjahr 1940 de Gaulle kennengelernt. Heute ist er Ehrenpräsident der > 

 Sie wurde von dem früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel begrüßt. Harpprechts zentrale Frage lautetete: „Aber ist der Nationalstaat tatsächlich die einzig zuverlässige Organisation der Völker? Zweifel
Sie wurde von dem früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel begrüßt. Harpprechts zentrale Frage lautetete: „Aber ist der Nationalstaat tatsächlich die einzig zuverlässige Organisation der Völker? Zweifel