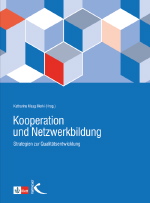Bientôt, je dois faire ma valise pour Jena : „Le VdF/F.A.P.F. V.(Verband der Französischlehrerinn- und lehrer e.V./Fédération allemandes des Professeurs de français) invite tous les professeurs de français de joindre le >
Congrés national du du 26 au 29 mars 2009 à Jena. La dévise du congrés „Enseigner les compétences, promouvoir la personalité“ offre à tous un forum des questions didactiques de tout gendre.“
Le Congrès offre un programme bien chargé:
> Le programme : > 80 conférences
> Les résumés des conférences. *.pdf
Le comité d’organisation précise sur le site qu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire aux conférences. Néanmoins, voilà les conférences que j’aimerais écouter:
L’ouverture du congrès aura lieu, jeudi, 26 mars (14 h à 15 h 30) en présence de de Monsieur l’Ambassadeur de France, Bertrand de Montferrand, qui, lui, est aussi l’auteur d’un blog.
En séance plenière, il y aura une première conférence:
Marion Perrefort, Universität Franche-Comté, Besançon
„Je pars pour apprendre la langue et puis…“
Le potentiel formateur du vécu dans la langue de l’autre dans la perspective des élèves
Ensuite du 16 h à 17 h 30, il y aura une première série de 11 ateliers:
et j’assisterai probablement à celui de Wolfgang Pütz, Learning by e-Learning. Praktische Informationen zum Einsatz von elektronischen Medien bei der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern
.
Vendredi 9 h 00 à 10 h30 :
J’ai choisi: Wolfgang Spengler, Stärkung der Mündlichkeit im Französischunterricht der Sekundarstufe I. Ein sprach- und handlungsorientierter Ansatz
11 h 00 à 11 h 45
Herbert Christ, Das deutsch-französische Geschichtsbuch – ein beispielloses Experiment, und was es für den Französischunterricht bedeuten kann Une bonne occasion d’écouter cette présentation, ce qui me fournit peut-être quelques idées pour le nouveau concept du site pour > le manuel franco-allemand dont je suis chargé actuellement.
La conférence Balzac et l’Allemagne: une histoire d’amour de Martine Gärtner m’intéresserait aussi.
12 h 00 à 12 h 45:
Je vais rater l’atelier d’Ute Tometten Sartres Huis clos – attraktiv und aktuell im Französischunterricht, car ma conférence Die französische Blogosphäre. Anmerkungen zu einer Mediendidaktik in der Oberstufe aura lieu au même moment.
> Sites Internets politiques en France et en Allemagne
16 h 00 à 17 h 30
Hans-Ludwig, Krechel, Bilinguale Module
Samedi, 9 h 00 à 10 h 30:
J’asssiterai à Evelyne Pâquier, Richard Bossuet, Éveil interculturel et apprentissage du français. Tout un programme avec TV5MONDE et www.tv5monde.com
Et pour la clôture du Congrès, je me réjouis de rencontrer Azouz Begag.

Übermorgen muss ich meinen Koffer für Jena packen: „Die VdF lädt alle Französischlehrerinnen und Französischlehrer sowie alle Interessierten sehr herzlich zum >
Nationalen Kongress vom 26. bis 28. März 2009 nach Jena ein. Der Kongress steht unter dem Motto „Kompetenzen schulen, Persönlichkeit fördern“ und bietet damit Interessierten aus Schule, Wissenschaft und Bildungspolitik ein Forum für didaktische Fragen aller Art.“
Der Kongress bietet ein reiches Programm:
> Das Programm: > 80 Ateliers und Vorträge
> Die Abstracts der Vorträge. *.pdf
Das Organisationskomitee erklärt auf der Website, man müsse keine nKonferenzen vorher buchen. Aber hier ist meine Besuchswunschliste:
Die Eröffnung des Kongresses wird am Donnerstag, 26. März (14 h à 15 h 30) in Anwesenheit des französischen Botschafters in Deutschland, Monsieur l’Ambassadeur, Bertrand de Montferrand stattfinden, der auch einen Blog schreibt.
Bei der Eröffnungsveranstaltung wird es einen ersten Vortrag geben:
Marion Perrefort, Universität Franche-Comté, Besançon
„Je pars pour apprendre la langue et puis…“. Le potentiel formateur du vécu dans la langue de l’autre dans la perspective des élèves
Zwischen 16 h und 17 h 30 gibt es einen ersten Block von 11 Vorträgen, und ich werde wohl Wolfgang Pütz, Learning by e-Learning. Praktische Informationen zum Einsatz von elektronischen Medien bei der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern zuhören.
Freitag, 9 h 00 bis 10 h 30, gehe ich zu Wolfgang Spengler, Stärkung der Mündlichkeit im Französischunterricht der Sekundarstufe I. Ein sprach- und handlungsorientierter Ansatz
11 h 00 à 11 h 45
Herbert Christ, Das deutsch-französische Geschichtsbuch – ein beispielloses Experiment, und was es für den Französischunterricht bedeuten kann Das ist eine gute Gelegenheit, mal aus einer anderen Perspektive über dieses > zweisprachige Unterrichtswerk einen Vortrag zu hören. Ich bin gerade damit beschäftigt, die Website für das Geschichtsbuch neu zu gestalten. Am Rande dieser Konferenz gibt es vielleicht interessante Gespräche über das Buch? Ich bin gespannt?
Der Vortrag Balzac et l’Allemagne: une histoire d’amour de Martine Gärtner hätte mich auch interessiert. Schade.
12 h 00 à 12 h 45:
Auch das Atelier von Ute Tometten Sartres Huis clos – attraktiv und aktuell im Französischunterricht werde ich verpassen, da mein Vortrag Die französische Blogosphäre. Anmerkungen zu einer Mediendidaktik in der Oberstufe zum gleichen Zeitraum stattfindet. > Blogs und Poliktik in Frankreich
16 h 00 à 17 h30
Hans-Ludwig, Krechel, Bilinguale Module
Samedi, 9 h 00 à 10 h 30:
Ich werde Evelyne Pâquier, Richard Bossuet, Éveil interculturel et apprentissage du français. Tout un programme avec TV5MONDE et www.tv5monde.com zuhören.
Und bei der Schlußveranstaltung freue ich mich darauf, Azouz Begag wiederzusehen.
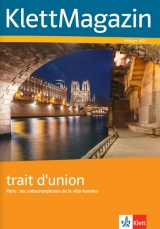




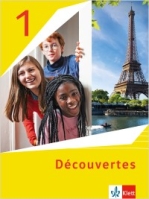







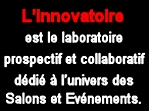


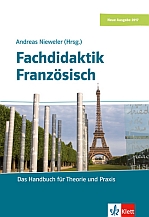
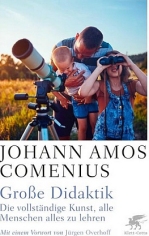



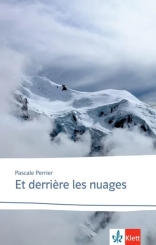
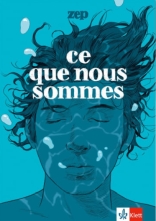
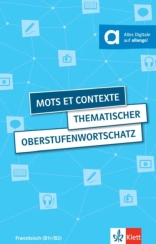
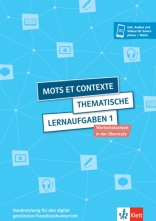
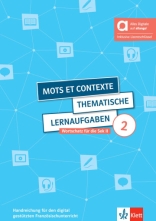
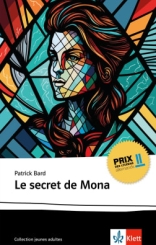

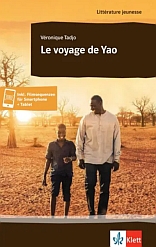

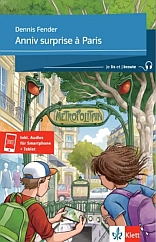

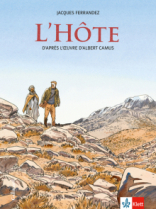

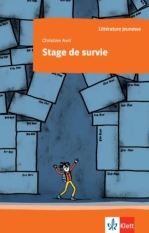
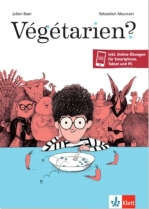
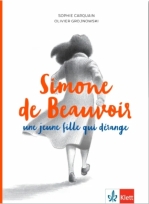
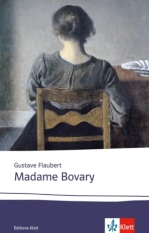
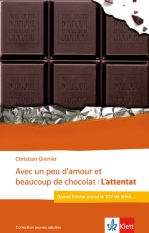
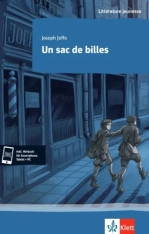
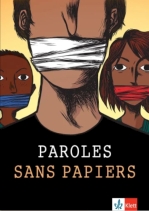

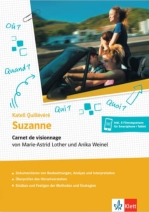
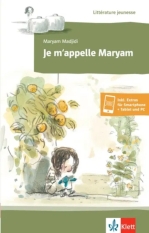

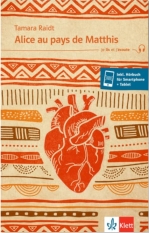

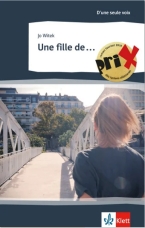

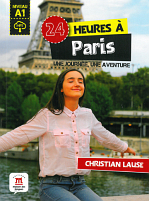




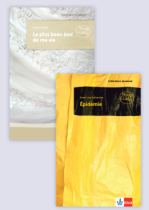
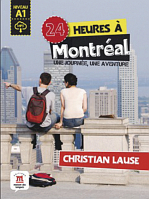
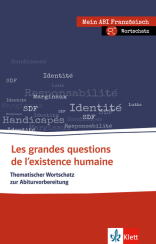
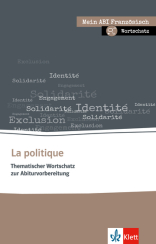

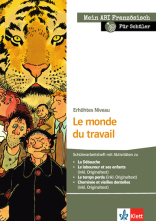
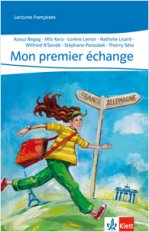
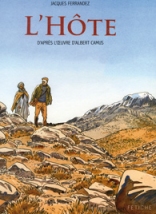
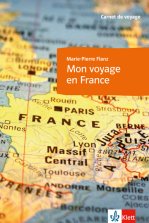
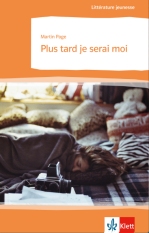
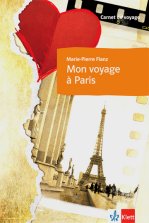



 Paroles & Musique 1 propose à vos élèves 15 chansons composées pour >
Paroles & Musique 1 propose à vos élèves 15 chansons composées pour > 



 Aber es darf auch die Frage gestellt werden, ob tatsächlich alles neu und anders werden muss? Ausser grundsätzlichen Anmerkungen zum Innovationsbegriff gab Professor Leupold mit diesem Vortrag auch einen Einblick in die Arbeit der >
Aber es darf auch die Frage gestellt werden, ob tatsächlich alles neu und anders werden muss? Ausser grundsätzlichen Anmerkungen zum Innovationsbegriff gab Professor Leupold mit diesem Vortrag auch einen Einblick in die Arbeit der >  Fremdsprachenunterricht keinesfalls nur von oben her ertragen muss oder sollte. Er setzt auf Netzwerkbildung und auf die Impulse, die aus dem immensen Erfahrungsschatz der in den Schulen tätigen Kollegen kommen. Sein Vortrag war spannend, weil er theoretische Ansätze unmittelbar mit dem Schulalltag verbindet, und gerade das nochmalige Anhören des Vortrags seine Entschlossenheit, die Innovationen aus den Schulen heraus zu fördern und zu fordern, sehr eindrucksvoll vorführt. Aus seinem 45 minütigem Vortrag habe ich 14 Minuten ausgewählt, um hier zumindest die Problematik anklingen zu lassen.
Fremdsprachenunterricht keinesfalls nur von oben her ertragen muss oder sollte. Er setzt auf Netzwerkbildung und auf die Impulse, die aus dem immensen Erfahrungsschatz der in den Schulen tätigen Kollegen kommen. Sein Vortrag war spannend, weil er theoretische Ansätze unmittelbar mit dem Schulalltag verbindet, und gerade das nochmalige Anhören des Vortrags seine Entschlossenheit, die Innovationen aus den Schulen heraus zu fördern und zu fordern, sehr eindrucksvoll vorführt. Aus seinem 45 minütigem Vortrag habe ich 14 Minuten ausgewählt, um hier zumindest die Problematik anklingen zu lassen.